Die Gefangenen der Schlackenhalde
19 Menschen ĂŒberleben im UnglĂŒcksstollen
an der Gelsenkircher StraĂe
Die schwersten Verluste gab es im Stollen unter der Schlackenhalde an der Gelsenkircher StraĂe. Der Bau wurde Anfang 1944 in Angriff genommen, war aber im Novemberimmer noch nicht fertig. Der Stollen sah wie ein Querschlag unter Tage aus. Der 2,5 Meter hohe Gang hatte Holzausbau, elektrisches Licht, enthielt BĂ€nke, zwei Krankenstuben, drei ZugĂ€nge mit Schleusen und fasste etwa 1.000 Menschen. Ein zweiter Stollen, erheblich kleiner, befand sich im Schlackenberg bei Optelaak. Ansonsten gab es hier nur SplittergrĂ€ben.
Um die vielen Kinderwagen aufzunehmen, mit denen die MĂŒtter zu den SchutzrĂ€umen kamen, wurde noch ein Seitenstollen angelegt. Er sollte 22 Meter lang werden. Anfang November fehlten dazu noch zwei Meter, auch die Hölzer waren noch nicht verbolzt. Vor allem: Es fehlte noch ein Notausgang. BaufĂŒhrer NiederbĂ€umer kamen schon beim Auffahren gewisse Bedenken. Meterlang waren die MĂ€nner durch lockere Schichten gefahren. AuĂerdem war die Deckung nur etwa sieben bis acht Meter stark, wĂ€hrend sie im Hauptstollen etwa zwölf Meter betrug.
Man wurde sich schon beim Bau darĂŒber klar, dass dieser Seitenstollen nur als Abstellplatz fĂŒr die Kinderwagen dienen konnte, aber schon am 1. November suchten auch Menschen darin Schutz. Am 6. November 1944 war Fritz Piwoda, Bergmann von Pluto, gerade dabei, die TĂŒr zum neuen Seitenstollen einzusetzen, als der Alarm kam.
Anna Rattay hatte keinerlei Zutrauen zum neuen Stollen. UnschlĂŒssig stand sie zunĂ€chst mit ihren vier Kindern davor. âIch gehe nicht hineinâ, sagte sie. Als man sie ermunterte, erklĂ€rte sie: âWenn, dann aber nur ganz hinten hin.â Haupt- und Nebenstollen fĂŒllten sich rasch. Als letzter kam der 14-jĂ€hrige Hans Syperek angelaufen. Seine Mutter und zwei Geschwister waren schon im Stollen. âEs ist akuteâ, rief Hans seiner Mutter ziemlich atemlos zu. Er hatte noch nicht Platz gefunden, da fiel auch schon die erste Bombe. Sie traf genau die Mitte des Seitenstollens. Und ebenso schnell erstickte der Aufschrei von Frauen und Kindern. Das Licht ging aus, der Stollen war verschĂŒttet.
Im Ă€uĂersten Ende des Stollens blieb ein Zipfelchen frei, nicht gröĂer als sechs Quadratmeter. Und auf diesen sechs Quadratmetern waren sechs Frauen und 13 Kinder Gefangene des Berges, deren Leidensweg mit Worten niemals wird wiedergegeben werden können. Auch die folgende Schilderung kann nur als Versuch gewertet werden. Anna Syperek, Bochumer StraĂe 278, stand am Ă€uĂersten Ende, die fĂŒnf Monate alte Hannelore im Arm. Sie konnte sich bewegen, obwohl der Sand ihr fast bis an die Arme reichte. MĂŒhsam wĂŒhlte sie sich frei. Ihre Jungen Hans und Arnold (6) waren beim Aufschlag der Bombe entsetzt zurĂŒckgewichen. Frau Syperek war es, als ob ihr Kopf platzen wĂŒrde. Sie fĂŒhlte mit der Hand, aber Ă€uĂerlich hatte sich nichts verĂ€ndert. Sophie Schmidt hielt ihren Dieter an sich gepresst. Auch sie war unverletzt.
âEingeschlossen, lebendig begrabenâ, sagt jemand
Anna Rattay, die eben noch unschlĂŒssig am Eingang gestanden hatte, fasste sich zuerst und versuchte, das Weinen, Schreien und Jammern zu ĂŒbertönen. Sie rief nach Licht. Eine halbe Kerze und eine Schachtel Streichhölzer kamen zum Vorschein. Im flackernden Lichtschein ergab sich ein erster Ăberblick. Auch die vier Kinder von Frau Rattay waren unversehrt geblieben: Hildegard, Dieter, Ursula und Rudi. Anna Rattay erkannte, in was fĂŒr eine Mausefalle sie geraten waren. Nur noch drei Hölzer standen. Vorne eine Wand aus festem Schlackensand, hinten ein Berg loser Steine: âEingeschlossen, lebendig begrabenâ, sagte jemand.
Dann sahen die Frauen, dass aus den eingebrochenen Sandmassen Arme und Beine herausragten. Frau Syperek und Frau Schmidt begannen zu wĂŒhlen. Zuerst kam Frau Anna Rogossinski zum Vorschein. Sie lag mit dem Gesicht gegen einen Stein gepresst, ĂŒber ihr ein Kinderwagen. Auch sie hielt ihr Kind im Arm, den erst sechs Wochen alten GĂŒnther. Beide waren benommen, erholten sich aber rasch. Schuhe und GepĂ€ck blieben verschĂŒttet. Ihre erste Frage galt ihren anderen beiden Kindern. Werner und Franz-Josef meldeten sich. Sie waren mit eingeschlossen.
Dann bemerkten die Frauen einen Haarschopf. Sie wĂŒhlten weiter und konnten auch Elfriede Sobiech mit ihrem sechs Monate alten Kind befreien. Mehr Kinder von Frau Sobiech konnten sie nicht finden. Else, Gerda und Fritz waren offenbar verschĂŒttet, aber genau wusste das zu dieser Stunde noch niemand zu sagen.
Und noch eine Frau wurde aus dem Sand gebuddelt: Elisabeth Krieter. Ihr zweieinhalbjĂ€hriges Töchterchen Elisabeth hatte schon verzweifelt nach ihr gerufen. Frau Krieter war schwer verletzt. Sie stand kurz vor der Geburt eines Kindes. Sie fĂŒhlte sofort, dass es mit ihr zu Ende ging. Selbst ein Arzt hĂ€tte ihr Kind und wohl auch sie nicht mehr retten können. Sie starb nach eineinhalb Stunden in den Armen ihrer Nachbarin.
âWo ist meine Mutti? Sie war doch eben noch hier.â
Niemand vermochte zu schildern, wie es zu dem Entschluss kam, Elisabeth Krieter hier unter der Erde zu begraben. Es bedurfte vielleicht dazu nicht einmal eines Wortes. Das Schicksal zwang die Frauen zu diesem Schritt, denn schon jetzt spĂŒrten sie, dass sie mit jedem Atemzug haushalten mussten. Als sie die Tote in eine Mulde gelegt und mit Sand bedeckt hatten, kam die unbarmherzige Frage des Kindes: âWo ist meine Mutti, sie war doch eben noch hier?â
Nun waren es noch achtzehn. Und die Frauen und Kinder waren zu dieser Stunde erst am Anfang ihres Leidensweges. Elfriede Sobiech hatte es besonders schwer, denn fĂŒr sie war es so gut wie Gewissheit, dass ihre anderen drei Kinder verschĂŒttet sein mussten. Einige Frauen verfielen in Lethargie. Frau Rattay und Frau Syperek sannen nach, was sie selbst zu ihrer Rettung tun könnten. Sie bauten auf ihre MĂ€nner.
Dann fiel ihnen ein, dass im Stollen irgendwo eine Hacke gelegen hatte. Frau Syperek, echte Bergmannsfrau, die von ihrem Mann manche Bergmannsgeschichte gehört hatte, wusste sofort, was damit zu machen war, als sie die Hacke gefunden hatten: âHansâ, sagte sie zu ihrem Jungen, âgib Klopfzeichen.â Der Junge schlug auf den Boden, bis er einfach nicht mehr konnte. Seine Mutter löste ihn ab, dann Frau Rattay, dann die anderen Frauen. Zwischendurch lauschten die Eingeschlossenen immer wieder, aber es kam keine Antwort.
FĂŒr die Frauen und Kinder war es seit 14 Uhr Nacht. Die Kerze wurde kleiner, man machte sie aus, um wenigstens einen Rest fĂŒr den schlimmsten Fall zu behalten. Dann wurde es auch drauĂen Nacht. Die Gefangenen des Schlackenberges merkten es freilich nur an ihrer Uhr und an der bleiernen MĂŒdigkeit, die sie ĂŒberfiel. Und immer schwĂ€cher wurde die Hoffnung, weil es immer noch totenstill blieb, wenn die Klopfzeichen eingestellt wurden.
In diese Grabesstille hinein flĂŒsterte dann zum erstenmal ein Kind: âMutter, ich habe Durst.â Sophie Schmidt meldete sich. Sie hatte ein Brot, ein halbes Pfund Butter und ein Glas mit eingemachten Bohnen bei sich, weil sie vom Alarm beim Einkauf ĂŒberrascht worden war. Ein Brot und ein bisschen Bohnenwasser fĂŒr 18 Menschen!
Die Kinder kamen zuerst an die Reihe. Mit dem Bohnenwasser wurden ihre Lippen benetzt. Ebenso sparsam ging man mit Brot und Butter um. Wer es noch aushalten konnte, musste zurĂŒckstehen. Man begann auch, mit der Luft hauszuhalten. Wer nicht gerade Klopfzeichen gab, verhielt sich ruhig. So rannen die Minuten trĂ€ge durch die Nacht, und ein neuer Tag begann. Der Durst wurde nun auch fĂŒr die Erwachsenen zur Qual. Die Kinder bettelten nach Wasser. Der Essensvorrat war lĂ€ngst verbraucht. Frau Sobiech, die ihre Kinder im Berg wusste, war nahe daran, ihren Verstand zu verlieren. Die MĂŒtter benetzten schlieĂlich die Lippen ihrer Kinder mit dem eigenen Speichel, soweit das ĂŒberhaupt noch möglich war.
Wer mag all die Qual und die Gedanken heute auch nur annĂ€hern zu ermessen. Im Schlackenberg wurde selbst die tote Frau Krieter beneidet. âSie hat es hinter sichâ, sagte jemand, und es war nicht die einzige Frau, die so dachte, trotz aller Zuversicht, dass drauĂen die MĂ€nner bestimmt alles unternehmen wĂŒrden, um sie zu bergen. Diese Zuversicht hielt die letzten bei Kraft, vor allem Anna Syperek, die nicht mĂŒde wurde, ihren Jungen zum Klopfen anzuhalten und dann selbst immer wieder Zeichen gab. Aber auch dieser Tag ging vorĂŒber ohne eine Antwort. Eine neue Nacht kam und ein neuer Tag brach an. Und als es Mittag wurde, ging auch das letzte bisschen Luft zur Neige. Die ersten der Eingeschlossenen verfielen in einen totenĂ€hnlichen Schlaf.
Auf der anderen Seite des Stollens, wo Fritz Piwoda damit beschĂ€ftigt war, die EisentĂŒr anzubringen, hatte die Bombenexplosion ebenfalls Entsetzen ausgelöst. Piwoda flog nur die MĂŒtze vom Kopf, aber er sah, wie die hereinbrechenden Schlackenmassen Kinder und Frauen verschlangen. Nur wenige erreichten noch den Ausgang. Piwoda stellte Ăberlegungen an, dass noch ein Rest des Stollens stehen mĂŒsste, aber das war vorerst nur eine vage Vermutung.
Gustav Sobiech, Heinrich Krieter, Otto Syperek und Gustav Rattay kamen hinzu. Gemeinsam gingen die MĂ€nner ans Werk, doch schon im Anfangsstadium erkannten sie, was fĂŒr eine kritische Aufgabe vor ihnen lag. Je mehr Sand sie von der Einbruchstelle wegschaufelten, desto mehr rutschte von oben nach. Inzwischen war auch Einsatzleiter Otto Haake von der Partei eingetroffen. Er brachte etwa 100 russische Kriegsgefangene aus dem nahen Lager der Zeche Pluto mit. Von der Königsgrube kam ein weiterer Einsatztrupp. Haake lieĂ von oben Sand und Schlacke aus dem Bombentrichter ausheben, aber auch von oben rutschten sofort Steine und Sand nach.
âOnkel, ich hab solchen Durstâ
Es kam zum Disput. Die einen wollten einen Bagger von den Eisenwerken heranholen, die FamilienvĂ€ter waren dagegen, vor allem Piwoda: âWenn noch Lebende im Stollen sind, dann bekommen sie durch den Bagger den Restâ, meinte er. Ein erneuter Alarm vereitelte schlieĂlich den Plan mit dem Bagger. Nach dem Alarm wurde erwogen, seitlich einen neuen Stollen anzusetzen. Gegen 23 Uhr kam man an die ersten VerschĂŒtteten heran. Man fand Agnes Nowitzki, RolandstraĂe 57, und stellte fest, dass sie vermutlich gerade erst gestorben war. Auch ihre beiden Kinder Franz und Karin lebten nicht mehr. Aber das jĂŒngste Kind der Familie Nowitzki, die neun Monate alte Inge, lag unversehrt unter einer Bank. Ihr war nichts geschehen. Vor dem Schlackenstollen hatte sich inzwischen Dr. Frahm eingefunden und nahm das Kind sofort in seine Obhut.
Immer zahlreicher wurden die Opfer. Von Familie Rafael aus der RolandstraĂe fanden die MĂ€nner CĂ€cilie Rafael und ihre Kinder Edelgard, Irene, Manfred, Rolf und Lothar, allesamt tot. In dieser Situation geschah etwas Unfassbares. Vor Haake bewegte sich plötzlich ein Kinderköpfchen. Im nĂ€chsten Augenblick hörte er die Stimme eines kleinen Jungen: âOnkel, ich hab solchen Durst.â Schnell rief Haake Hilfe herbei. Vorsichtig wurden Erde und Holz entfernt. Dann wurde der Junge herausgezogen. Es war Friedhelm Rafael, einziges Kind der Familie, das den Angriff ĂŒberlebte. Friedhelm war ebenfalls unter eine Bank geraten. Ein Rundholz hatte sich quer darĂŒber gelegt und den Druck des Berges abgefangen.
Der Kampf gegen die nachdrĂŒckenden Sandmassen war mĂŒhselig. Aber man kam weiter. Im gleichen MaĂ wuchs die Zahl der Opfer. Man fand Franziska Stelmaszyk und ihren Jungen Manfred, Luise Piwoda und ihr Töchterchen Gudrun, schlieĂlich drei Kinder der Familie Sobiech, Ilse, Gerda und Fritz.
Es war am Morgen des zweiten Tages nach dem Angriff, als Otto Syperek und Otto Haake zum erstenmal Klopfzeichen vernahmen. Die Bergungsmannschaften waren etwa zehn Meter im Stollen vorgerĂŒckt. Spontan hielten sie mit ihrer Arbeit ein und lauschten. TatsĂ€chlich, das Klopfen wiederholte sich! 40 Stunden waren seit dem Angriff vergangen. Sofort erfĂŒllte alle MĂ€nner neuer Mut. Aber diese letzten vier Meter bis zu den Eingeschlossenen hatten es in sich. Noch siebeneinhalb Stunden waren notwendig, um auch sie zu ĂŒberwinden, dann tat sich vor den MĂ€nnern ein dunkles Loch auf. Otto Haake leuchtete in die Höhle. âWie viele leben noch?â war seine erste Frage. Die Frauen hatten die GerĂ€usche bereits vernommen. Sie waren plötzlich wieder wach. Und als die erlösende Frage kam, riefen sie spontan zurĂŒck: âAlle!â
âIch will kein Verdienstkreuz, ein Kotelett ist mir lieber!â
Nacheinander kamen die leidgeprĂŒften Frauen und Kinder ans Licht. Dr. Frahm stand schon bereit. Die kleine Annelore Syperek, fĂŒnf Monate alt, war ohne Besinnung. Dr. Frahm fuhr sie mit seinem Wagen sofort ins Herner Krankenhaus. Nach intensiver Sauerstoffbehandlung kam auch sie allmĂ€hlich wieder zu sich. Dem kleinen Hans Syperek, der so tapfer mit der Hacke Klopfzeichen gab, wollte man das Kriegsverdienstkreuz anheften. âEin Kotelett ist mir lieberâ, sagte er. Otto Syperek lieĂ noch am gleichen Tag seine Familie evakuieren.
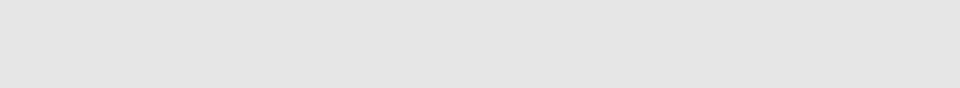
powered by:

|
|
||
|
|

